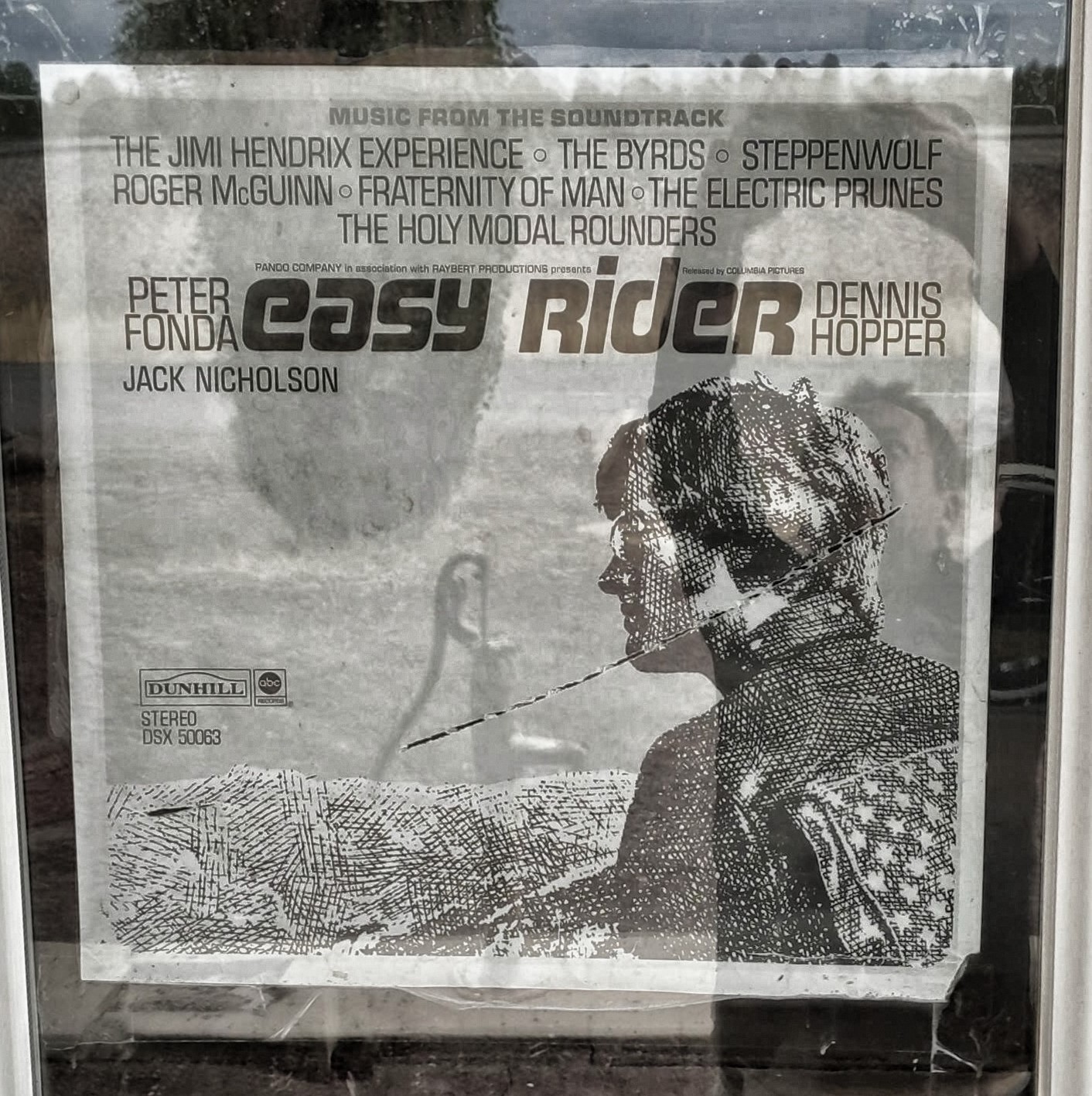Eine Million Gäste im Jahr, alptraumhaft volle Strände, Bauboom und lange Staus bei An- und Abfahrt. Die Insel Usedom ist der Deutschen liebstes Sonneneiland. 66 Kilometer lang und 24 breit liegt die Insel in der Pommerschen Bucht, eine Geldmaschine für Hoteliers und Kneiper, oft ein Alptraum für die 76.000 Einwohner, die seit jeher vom Massentourismus leben, seit der Wiederentdeckung der heimatlichen Strände durch Türkei-, Ägypten- und Tunesienurlauber aber über Verkehrsinfarkt und hohen Mieten stöhnen.
Die andere Seite von Usedom ist trotzdem noch da: Einsame Strände, endlose Sommerwiesen voller Tiere und der Sternenhimmel über dem taufeuchten Sand. Doch wer dieses Geheimnis entdecken will, muss abtauchen in die Illegalität einer Reise, die vom ersten Schritt an verboten wäre, bekäme ein Strandvogt, ein Polizist oder ein Ordnungsamtsmitarbeiter Wind davon.
Strandwandern auf Usedom funktioniert dennoch erstaunlich gut. Wenn bestimmte Regeln beachtet werden. Die Herausforderung dieser Reise ist klar - kein Hotel, kein Zeltplatz, keine Pension und kein Airbnb-Zimmer. Nur Natur, eine Woche lang, mit Zelt am Strand oder im Wald. Ein verrückter Plan. Mal sehen, was draus wird.
Mit so viel Gepäck, wie dazu nötig ist, kann sich natürlich niemand unsichtbar machen. 17 Kilogramm wiegt der Rucksack, ohne die Wanderschuhe, die anlässlich der ersten Strandetappe außen herumbaumeln. Deutschland liegt im Sand, schon in Ahlbeck, dem östlichsten Ort Usedoms, dicht an dicht eng gedrängt im Ostseesand. Wie Außerirdische wirken da Wanderer, die es offenbar direkt aus den Alpen hierher verschlagen hat. Immer am Meer entlang bis Peenemünde, das ist die geplante Route. Von dort ein Schwenk ins Inselinnere. Und weiter am Ufer der Peene entlang nach Süden zum Achterwasser, ehe es zurück an die Ostseeküste geht.

Für geübte Bergwanderer ein Spaziergang, denn so etwas wie Höhenmeter gibt es nicht, abgesehen von einem Abstecher zu einem ehemaligen DDR-Ferienlager, das zwei Kilometer hinter Bansin versteckt im Wald liegt. Malerische Ruinen künden von längst vergangenem Ferienspaß, grün überwuchert der Wald die Reste dessen, was einmal das vielbegehrte Urlaubsidyll irgendeines inzwischen sicher längst abgewickelten DDR-VEB war. Nicht einmal der Abriss lohnt sich hier, die Natur holt sich die Pappbuden ganz von selbst zurück. Und bis dahin amüsieren sich die örtlichen Graffiti-Sprayer im früheren Speisesaal.

Zurück am Strand heißt es nun, nur nicht zu weit laufen. Wer auf Usedom wandert und vor hat, sich den Aufenthalt auf den gigantischen Campingplätzen zu ersparen, deren schiere Ausmaße an sozialistische Neubaustädte erinnern, ist gut beraten, wenn er sich an den Gemarkungsgrenzen zwischen den einzelnen Gemeinden orientiert. Dort, wo die Strände leer sind, weil den meisten Hotelgästen die 500 Meter in die freie Natur viel zu weit sind, heißt es, die anbrechende Nacht abzuwarten. Mit der Dämmerung kommen die Jogger, dann die Hundehalter auf ihrer letzten Runde. Und danach packen die Wanderer ihre Zelte und Planen aus, um sich im Schatten der Steilküste einzurichten.
Klar ist - spätestens am zweiten Tag ist der Sand überall. In jeder Ritze, jedem Eckchen, selbst zwischen den Zähnen knirscht er immer wieder unvermittelt. Dafür steigt eine strahlende Sonne über dem menschenleeren Strand auf und die Ostsee gehört den Wildcampern ganz allein. Zelt zusammenpacken, Schlafsack einknüllen, Rucksack auf, weiter geht es Richtung Nordwesten. Kaffee zum Runterspülen der Sandkörner gibt es zum Glück gleich nebenan am Ortsrand von Ueckeritz.
Dahinter verändert sich der Sand, der Strand wird schräger, der Weg tiefer. Dafür aber ist es hier nicht mehr ganz so voll wie in den selbsternannten "Kaiserbädern" Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Mit gemütlich vier Kilometern in der Stunde geht es Richtung Nordwesten, am Horizont ist der Peenemünder Haken schon zu sehen, mit dem der bewanderbare Strand enden wird.
Einmal noch übernachten bis dahin, gleich neben einem Kioskgrill zwischen dem kleinen Zempin und der Urlaubsmaschine Zinnowitz. Um sechs morgens kommt der Müllmann und leert die Mülleimer, die mit dafür sorgen, dass die Strände auf Usedom sauber sind wie eine Fünf-Sterne-Hotelküche: Auf 40 Kilometer Strecke wird keine einzige Plastiktüte, kein verlorener Badelatsch und kein geplatzter Ball am Boden liegen. Abends kommen erst die Jogger, dann die Hundehalter, am Ende ein paar leicht angeschickerte Gruppen, die die Cocktails im jeweiligen Nachbarort verkostet haben.
Der Himmel ist noch durchsichtig blau, vor dem Hafen von Swinemünde, der ganz im Osten liegt, hat sich eine Warteschlange von Schiffen gebildet. Auf der anderen Seite blinkt der Leuchtturm von der Greifswalder Oie herüber, der Booten den Weg weißt, die es nicht gibt.
Hier hinten kurz vor dem Sperrgebiet sowieso nicht. Hinter Trassenheide kehrt Usedom langsam zu seinem natürlichen Zustand zurück. Karlshagen liegt noch am Strandrand, ein letztes Aufbäumen der Käfighaltung für Jahresurlauber und ein Strandvogt, der im Gebüsch am zentralen Platz mit der üblichen Konzertmuschel lauert, um Verdächtigen die Kurtaxe abzuverlangen. Das Ende der Usedomer Welt folgt auf dem Fuße: Vier Kilometer weiter wird der Strand breiter, das Wasser flacher und der Dünenwald dichter.

"Hier hat man noch seine Ruhe", sagt ein Einheimischer, der vor Sonnenuntergang kurz vor Haken, Struck und Rudenmm noch einmal ins Wasser steigen will. Hinter dem letzten Schilfgürtel fängt das Vogelschutzgebiet an, von dem die Peenemünder sagen, dass es zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: "Überall im Wald liegen noch Bomben, die nicht explodiert sind", beschreibt der späte Badegast, "hätten sie alles teuer beräumen müssen, wenn sie nicht das Schutzgebiet draufgepackt hätten." In dessen Schatten liegt nun so viel Einsamkeit, wie sie eine Insel wie diese hier eigentlich gar nicht haben kann. Aber Warnschilder mit "Vorsicht, Munition, Betreten verboten", entfalten ihre eigenen Wirkung.
Dadurch aber führt kein Weg um den Haken, sondern nur bis zu einem Zaun, an dem weitere verwitterte Schild vor dem Betreten der auch fast acht Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch munitionsverseuchten Bereiche um das frühere Raketentestgelände des Wernher von Braun warnt. Es seien da überall wirklich von alliierte Bomben im Boden, die bei Angriffen auf die V2-Fabrik fehlgingen. "Dort vorn", sagt der schwimmfreudige Rentner, "liegen sogar noch Flugzeugteile".

Eine Begegnung mit der Geschichte, von der Gegenwart überstrahlt. Am einsamsten Strand von ganz Usedom wohnt in diesem Jahr ein echte Einsiedler, der sich aus Kieferästen und einer Plane eine Art Zelt gebaut hat. Er schlafe abends am Feuer, stehe mit den Vögeln auf und wundere sich mittlerweile auch schon, dass ihn alle in Ruhe ließen, sagt er. "Aber ich tue ja auch keinem was." In Rostock geboren, sei er vor Jahren nach Berlin gezogen, habe nun aber festgestellt, so der Mittdreißiger, dass die Hektik und das Großstadtleben ihn für den Moment überforderten. "Da ist mir diese Stelle hier eingefallen, wo man nur mit sich selbst und der Natur ist." Als sich der Abend senkt, zündet der Einsiedler sein Feuer an, die Mücken kommen und gehen wieder und mit der Dunkelheit steigt eine Ruhe auf, wie sie nicht tiefer sein könnte.
Auch morgens sind keine Menschen zu sehen. Der Weg führt jetzt kurz zurück und dann an einer Straße entlang, die den einzigen sicheren Weg durch die Sperrzone markiert. Wie fast überall im Nordosten der Insel, die im Jahr auf fast 2000 Sonnenstunden kommt, gibt es nach einer kurzen Strecke Nur-Straße Rad- aber keinen speziellen Wanderwege, obwohl das hier der Europawanderweg E9 sein soll. Was hat zuerst gefehlt? Die Wanderer? Oder die Wanderwege?

Peenemünde, der einzige größere Ort auf dieser Schmalseite des Eilands, kommt auf gerademal 300 Einwohner, einen Konsum, eine Gaststätte, ein U-Bootmuseum, eine Physikausstellung und die Reste der imperialen Zweckbauten der Waffenindustrie des Dritten Reiches, die längst als Hauptattraktion der Region gelten. "Früher kamen Auswärtige nicht mal in die Nähe von Peenemünde", beschreibt die Kellnerin der "Alten Wache", "da saß hier überall die NVA und man brauchte einen Passierschein, um in den Ort zu kommen." Heute lebt der vom betonierten Erbe der Raketenpioniere, denn "mit Strand ist hier nicht viel". Und vom Bedürfnis zahlloser Usedom-Urlauber, ihre mitgebrachten oder gemieteten Fahrräder zu nutzen, um zu allen möglichen interessanten oder auch weniger interessanten Zielen vorzudringen.
Die Peene-Seite der Insel bleibt dabei aber für die meisten tabu. Hier, wo die einzige Attraktion aus dem
Hochwasserdamm besteht, an dem entlang sich ein alter LPG-Weg schlängelt, dünnt die endlose Kette der Fahrradfahrer aus. Schon an den nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengten Materialbunkern der Brauchitsch-Truppe klingelt es nur noch gelegentlich. Es wird wieder still und das Land weit, Felder und urwaldartige Baumgruppen prägen die Landschaft. Das Meer ist nicht mehr zu sehen und bei Mölschow ist auch kein Hauch von Ostseeduft mehr in der Luft.
Usedom sieht hier aus wie das Mansfeld, eine in der Sonne glühende Veranstaltung, aus der es keine Flucht gibt. Die auf den Wanderkarten eingezeichneten Schutzhütten existieren nicht, auch findet sich kein Stückchen ebene Wiese, auf dem sich das Zelt noch vor den nahenden Gewitter aufstellen lassen könnte. Die Wanderung wird zur Suchaktion, quer über abgeerntete Staubfelder und durch trockengefallene Bewässerungsgräben. Rehe und Hasen sagen sich hier gute Nacht. Touristen gibt es nicht mehr, und überhaupt keine Menschen. Dann endlich ein Stück Wäldchen mit Rasen dahinter, Schutz vor dem böigen Westwind und uneinsehbar für neugierige Bauersleute im Ort. Im Pladderregen eines Sommergewitters geht der Abend zu Ende. 60 Kilometer geschafft. 25 zu gehen.

Kein Durchkommen hierhin gab es noch vor 30 Jahren. Der Nordwestteil Usedoms war jahrzehntelang Sperrgebiet. Erst bauten die Nazis rund um das Fleckchen Peenemünde im abgelegenen Gebiet um den Haken ihr Testgelände für Wernher von Brauns V1 und V2 genannten Raketen. Dann kam die Nationale Volksarmee der DDR und errichte einen Sperrgürtel, hinter den niemand schauen durfte.
Erst seit dem Ende der DDR kann das Areal besichtigt werden, auf dem die Nazis im Krieg ihre "Vergeltungswaffen" entwickelten. Ein Museum empfängt jedes Jahr mehr als 300.000 Besucher, in den Außenanlagen sind Modelle und Reste von echten V2-Raketen verteilt. Daneben gibt es eine Ausstellung mit Wundern der Physik und ein ehemals sowjetisches U-Boot, das begangen werden kann.

Abseits dieses Überbleibsels aus der unseligsten Zeit der deutschen Geschichte erstreckt sich weites Wald- und Wiesenland, 25 Quadratkilometer groß, menschenleer. Nirgendwo ist hier eine Möglichkeit, einzukaufen, etwas zu trinken oder eine Wurst zu kaufen. Der Europawanderweg E9 ist ein alter LPG-Pfad aus Betonteilen, die bessere Wahl ist allemal der Deich, der nicht betreten werden darf. Seit den 30er Jahren sind hier nur Einheimische unterwegs gewesen, bis heute sogar, denn im Verkehrschaos der überforderten Insel nehmen Auskenner den alten Wirtschaftsweg als Abkürzung auch mit dem Pkw. Die Wachen, die hier früher standen, sind fort, die zwölf Jahre, die hier ein Zentrum der Rüstungsindustrie der Nationalsozialisten war, haben allerdings ihre Spuren hinterlassen.
Unübersehbar. Im Wald warnen Schilder diplomatisch vor "Munitionsbelastung", am Wegesrand türmen sich die Trümmer früherer Bunkeranlagen. Die hatten die Nazis zwangsweise auf den weichen Boden bauen müssen, weil Tiefbunker im Usedomer Sand keinen Sinn gehabt hätten. Nach dem Krieg galten die halbtonnenförmigen Riesenschuppen als Teil der deutschen Bewaffnung und nach den Vorgaben des Potsdamer Abkommens mussten sie deshalb gesprengt werden.

Was übriggeblieben ist, reicht als Touristenattraktion. Überall türmen sich die Betonhaufen, in denen Teile der geplanten "Wunderwaffen" gelagert worden waren. Vieles ist längst von einer Flora überwuchert, die sich seit dem Abzug der NVA ungestört entwickeln konnte. Stumme steinerne Zeugen von Weltgeschichte: Von hier aus gelang der Menschheit am 3. Oktober 1942 der erste Ausflug in den Weltraum, als ein Raketenofen mit 18 Mischkammern zündete und in seinem Inneren pro Sekunde 125 Liter Kartoffelschnaps und flüssiger Sauerstoff verbrannten, bis das 13 Tonnen schwere ""Aggregat 4" die Grenze zum Weltraum überschritten hatte. Mit Überschallgeschwindigkeit erreichte die Rakete in einer Höhe von 84,5 Kilometern die Grenze der Erdatmosphäre und schlug 190 Kilometer entfernt in der Ostsee ein.

Über 10 000 Menschen hörten damals, wie das ohrenbetäubende Grollen des Triebwerks über die flache Landschaft rollte. Um 15.58 Uhr hob das Aggregat vom Starttisch ab und nahm Kurs auf die Danziger Bucht. In 80 Kilometer Höhe waren die Tanks leer. Keine Spur erinnert mehr daran, dafür aber gemahnen die Bunkerreste, die aussehen wie übergrünte Hünengräber, an die Vergänglichkeit aller Macht.
Wer hier auf den Rad vorbeifährt, wie es nur wenige tun, oder entlangwandert, was niemandem in den Sinn zu kommen scheint, ist auf Spurensuche. All diese Hinterlassenschaften wurden zwischen 1939 und 1942 mit Hilfe von Zwangsarbeitern erbaut und seitdem zerfallen sie mit quälender Landsamkeit. Beeindruckender noch als die Dokumente, Waffenteile, Fotografie, Videos und Modelle in der offiziellen Schau im Museum lassen die steinernen Reste der "Heeresversuchsanstalt", in der Entwicklung und Bau der Flügelbombe Fi 103 und der ersten Großrakete A 4 betrieben wurden, erahnen, welche Hybris hier herrschte. Niemand wusste, dass man im Begriff war, die Basis für die spätere Raumfahrt zu schaffen. Nicht die Eroberung des Alls, sondern der Erde war das Ziel.

Von 1936 bis 1943 wurden in der Usedomer Wald- und Wiesengegend etwa 70 Großbauten errichtet, dazu eine Wohnsiedlung für die Wissenschaftler, ein eigenes Wasser- und Kraftwerk sowie eine elektrisch betriebene Werkbahn. Ferner Lagerbauten als Massenunterkünfte für Soldaten, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Dass daraus einmal ein magisch-mysteriöser Ort werden würde, den Neugierige staunend durchwandern können, während Reste von Wasserzisternen, Unterführungen und stillgelegten Bahngleisen andeuten, wie gigantisch diese Anlagen einst waren, von denen außer der Kraftwerksruine nichts vollständig erhalten geblieben ist, hatten Wernher von Braun und General Walter Dornberger als führende Köpfe der Entwicklung einer Fernrakete, die 750 Kilogramm Sprengstoff über eine Distanz von 250 Kilometern transportieren sollte, weder vorgesehen noch geahnt.

Der Atem der Geschichte, hier weht er leise, aber deutlich muffig riechend. Keine zehn Kilometer entfernt gibt es die Reste eines Zwangsarbeiterlagers zu besichtigen, im Museum kann man lesen, dass allein beim ersten Luftangriff der Royal Air Force auf Peenemünde im August 1943 etwa 750 Menschen ums Leben kamen, darunter vermutlich 500 ausländische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Die Bunkerreste am LPG-Weg reichten den Nazis danach nicht mehr aus, um ihre Wunderwaffen sicher zu wähnen. Die Produktion wurde nach Nordhausen in Thüringen verlagert. Häftlinge aus dem KZ Buchenwald mussten dort unterirdische Stollen für das Buchenwald-Außenlagers Mittelbau-Dora in die Felsen hauen, in denen ab Januar 1944 die Raketenproduktion begann. Bei der Errichtung der Anlagen sowie bei der Produktion starben bis zum Kriegende über 20 000 Häftlinge - die V2 forderte so mehr Opfer bei denen, die sie bauen mussten, als bei denen, die sie töten sollte.

Nur weg aus dem Hinterland, aus Orten wie Zecherin und Mölschow, die nur ein paar Kilometer von den vielbesuchten Stränden bei Zinnowitz entfernt liegen, aber wirken wie Teile einer anderen Welt. Selbst im Hochsommer ist hier hinten niemand und so offenbart sich der landschaftliche Zauber der Insel Usedom, der weite Flächen bietet, dschungelhafte kleine Wälder und tuckernde Traktoren. Wie ein Schock kommt Trassenheide, der Vorhof des Urlaubsmolochs Zinnowitz, der von endlosen Radlerkolonnen bevölkert wird. Alles fährt, auf dem Kurplatz lauert der Strandvogt, der die Kurabgabe eintreibt. Zum Glück sind die Zelte, aufgebaut erst nache Einbruch der Dämmerung, selbst aus ein paar Metern Entfernung kaum zu entdecken. Wer sie trotzdem sieht, geht meist kopfschüttelnd vorbei. "Das ist bestimmt verboten", sagt eine Frau. "Das stört doch keinen", entgegnet ihr Mann und erklingt ein bisschen sehnsuchtsvoll.

Auf der Seeseite lässt es sich wieder unbekümmert am Strand entlanglaufen oder auf dem parallel zur Küste verlaufenden Wanderweg, der die offizielle Route des Europawanderweges 9 ist. Trotz der lauernden Blicke und des Kopfschüttelns der Tausenden am Strand geht es unten entlag, vorbei an Kleckerburgen und Festungen aus Planen. Am Streckelsberg bei Koserow wächst eine vergleichsweise scharfe Steigung aus dem Sand. 69 Höhenmeter! Für diese Gegend ist das das Matterhorn.

Die Versorgung ist immer sichergestellt, denn hier folgt Usedom wieder der Logik ständiger Abwechslung. Aus Stadt folgte Leere, auf Leere Stadt. Entlang der opulenten, kiefernbeschatteten Strandpromenade, an der sich in endloser Kette Strandvillen, Strandhotels und Strandrestaurants reihen. wandert es sich im aufkommenden Wind ruhig und gemächlich bis kurz vor Zempin, einen sympathischen Flecken, dem es noch am mallorcahaften Massencharakter mangelt. Der Strand unter einem Stückchen Steilküste, auf der der absurd große offizielle Campingplatz "Am Dünengelände" beginnt, der sich bis Zinnowitz hinzieht, sieht aus wie ein idealer Rastplatz für die Nacht.
Ein paar Jungs zelten hier gleich nebenan, illegal, aber schon eine gnaze Woche lang. "Gab nie Probleme" sagen sie, die allerdings kein richtiges Zelt aufgebaut haben, sondern nur ein Holzgerüst, über dem eine Plane liegt. Nach Landesrecht ist das kein Zelt, sondern mit viel gutem Willen ein Biwak. Und im Gegensatz zum Zelten am Strand ist biwaken erlaubt.
Oder wenigstens nicht verboten. Doch das ist egal, schließlich versiegt der Strom der Steinesammler, Hundeausführer und Jogger mit dem Dunkelwerden, durch das die letzten Auswärtsesser zurück zu ihren jeweiligen Heimatadressen stolpern. Die Nacht kommt, die ersten am Strand sind nun wieder die letzten, wie immer in dieser Woche so nah und so weit draußen zugleich.
Bildergalerie: