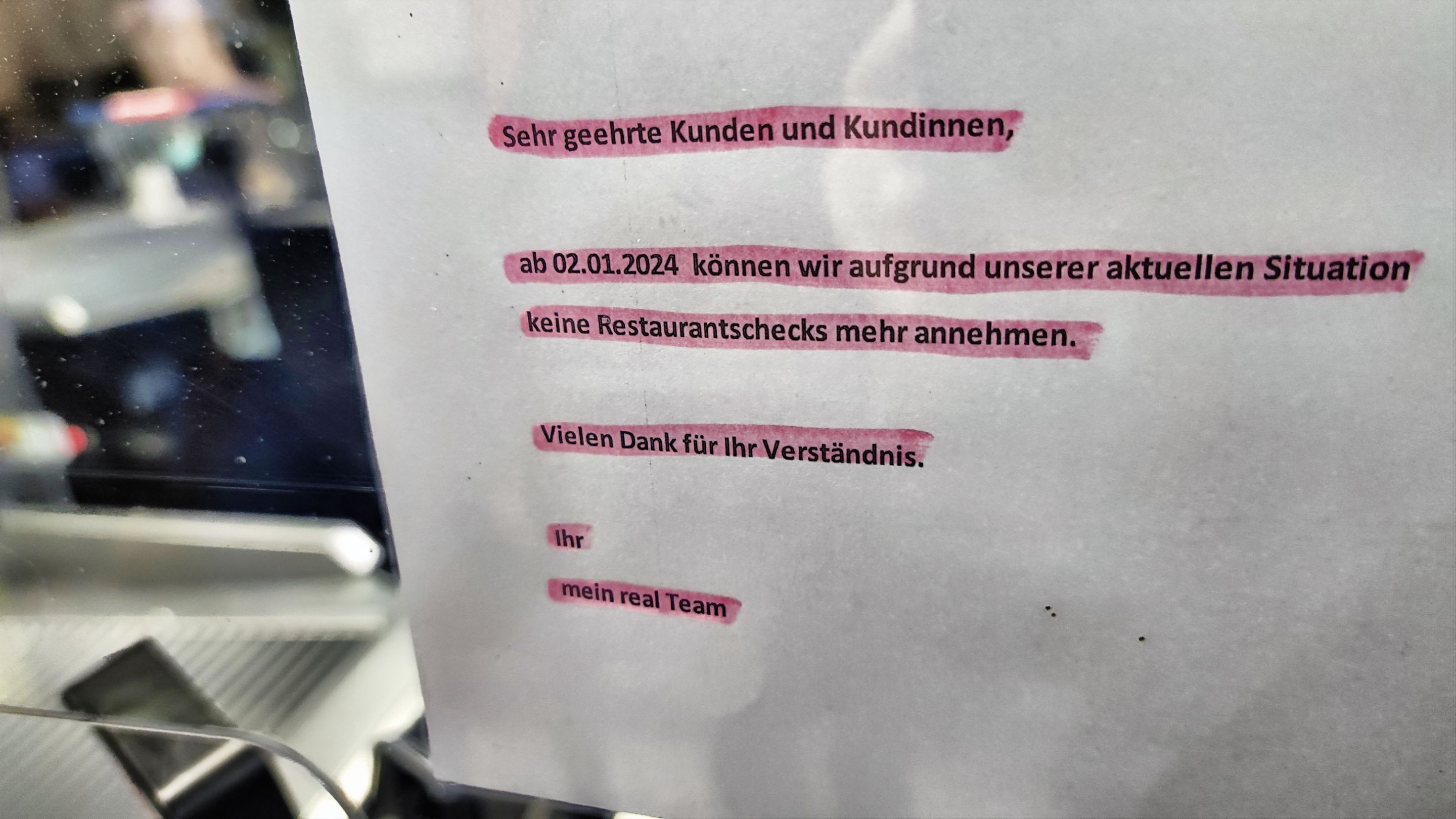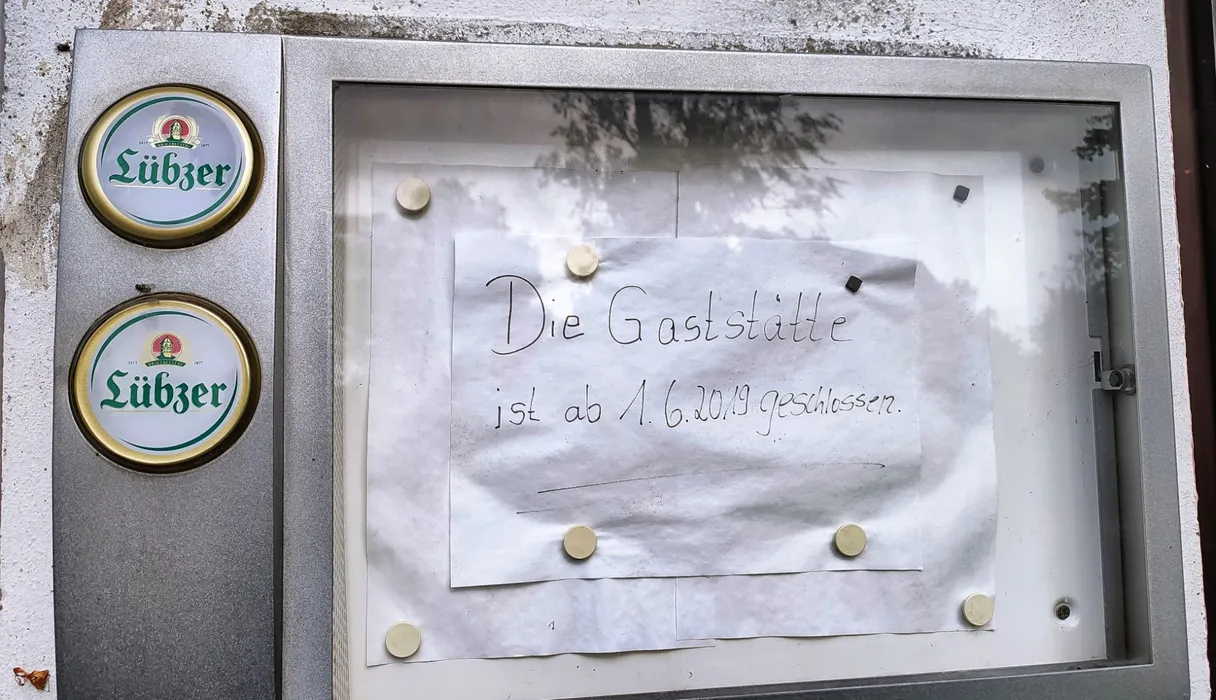Die OP-Maske, die auf der Peißnitzinsel in einem Baum hing, hat sich vor wenigen Tagen verabschiedet. 
Es ist vier Jahre her, dass die Welt sich von einem Tag auf den anderen veränderte.
von einem Tag auf den anderen veränderte. Überall herrschte Maskenpflicht, Menschen verschwanden unter Schutzausrüstungen, ein kollektiver Gesichtsverlust trat ein. Damals, als die ersten Vorschrift zur sogenannten Gesichtsbedeckung den Blick der Deutschen auf sich selbst für immer veränderten, sollten alle diese Masken tragen. Aber anfangs gab es keine zu kaufen.
Umso auffälliger war eine Maske, die ein Unbekannter an einen kleinen Baum in einem Park gehängt hatte. So niedrig, dass jeder sie sehen konnte. So hoch, dass niemand in der Lage war, sie herunterzuholen.
 |
| Vier Jahre hing sie im Baum, die Maske. |
Die blassblaue Maske überstand den ersten Sommer der Pandemie und den ersten Winter überstand sie auch. Unbeschadet hing sie an einem Zweig, vom Wind gebeutelt und vom Sturm zerzaust, nassgeregnet und anschließend wieder von der Sonne getrocknet. Es kam der Frühling und der nächste Sommer und sie war immer noch da, es kam der erste Ausnahmezustand namens "Lockdown"
null und der zweite, die erste Impfkampagne und die mit den Boostern. Und sie baumelte weiter unerbittlich in ihrem Baum, als wollte sie alle verlachen, die vor lauter Angst und Unsicherheit und vor Hiobsbotschaften und Beruhigungsversuchen nicht mehr wussten, was sie nun glauben sollten und überhaupt noch konnten.
Die Maske war stabil, auch wenn sich alles rundherum änderte. Die Impfungen, die vor Ansteckungen schützten, taten das dann doch nicht, aber die Maske war noch da. Die neue Welle, die noch schlimmer werden würde, wie der Gesundheitsminister nicht müde wurde zu betonen, kam nicht. Doch die Maske war noch da. Corona wurde vom Sonderfall zum Alltag, wie die Maske, die ganz nah an einem beliebten Spazierweg hing. Und hing. Und hing.
Vom Tag an, an dem der damalige deutsche Gesundheitsminister behauptete, dass „Mundschutz nicht notwendig ist, weil das Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist“, bis zum Tag, an dem selbst im Freien Maske getragen werden musste, betrachtete sie die Veränderungen von höherer Position aus. Eine einfache OP-Maske, die auf dem Höhepunkt der Krise zwei Euro kostete - 100 Mal mehr als in gewöhnlichen Zeiten. Sie das alles durchgehalten.
Der zweite Corona-Winter kam, der zweite Frühling, Sommer, Herbst und noch ein Winter. Als bleibe sie ewig jung, baumelte sie da oben, ein angeblich wirksames Viren-Abwehrmittel, das zum Denkmal einer verrückten Zeit wurde. Die Maske, im März 2020 auf den Baum geraten, hing dort noch im März vier Jahre später, etwas zerzaust, ein wenig fusselig, aber störrisch, als wollte sie ihren Platz nie mehr räumen.
Dann aber ist es doch passiert. Eines Tages war sie verschwunden, von einem kleinen Frühjahrssturm herabgeweht. Das Band war gerissen, der Mundschutz auf den Boden gefallen. Nach genau vier Jahren und zwei Monate, also 1520 Tagen, bestehend aus 217 Wochen, ist die Geschichte der letzten Maske vorbei.
 |
| Da liegt sie nun im Dreck. |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)