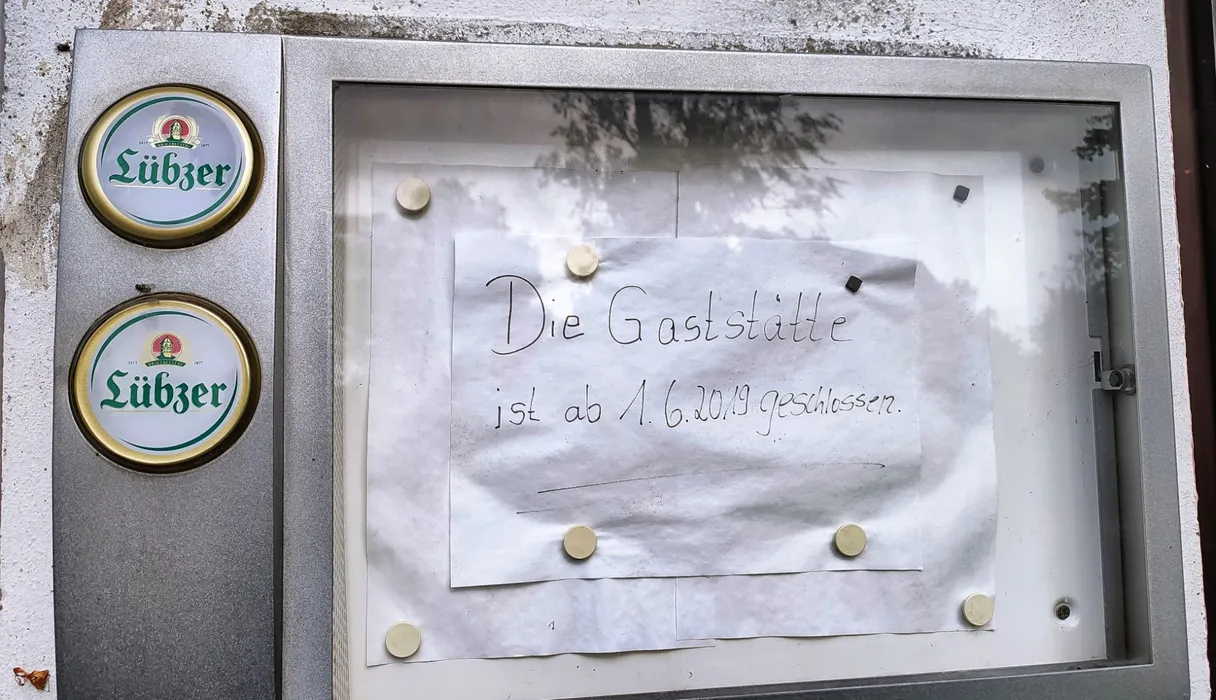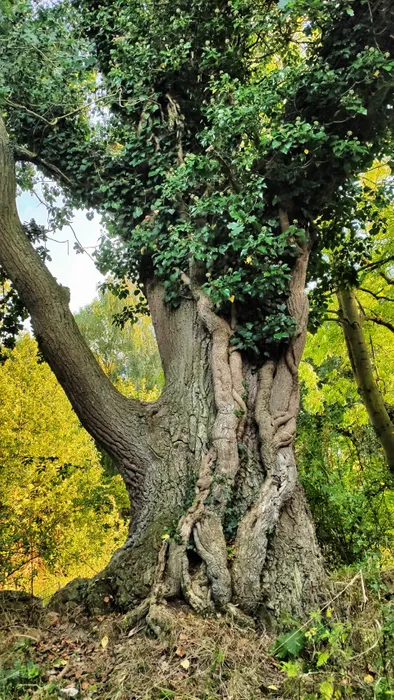Frage: Sie meinen, Sie haben sich bemüht, ein Wahlbündnis zu schaffen?
Schnur: Ja, genau. Für den Demokratischen Aufbruch kann ich sagen: Wir haben lange versucht, die neuen Kräfte zusammenzubringen. Ich glaube, das scheiterte letztlich an der damaligen SPD. Die hatte mit 75 bis 80 Prozent in den Befragungen so ein Gewicht, dass sie nicht teilen wollte. Dann fielen bei mir politische Entscheidungen: Ich sagte, gut, dann wenden wir uns der CDU zu. Das passte von der Programmatik und meiner eigenen Einstellung her. Für uns im Osten war das alles völlig neu, aber ich habe mich schnell zurechtgefunden. Man musste Allianzen schmieden – nicht nur die Allianz für Deutschland, sondern persönliche Allianzen. Die richtigen Leute an die richtigen Stellen setzen. Wir waren Lehrlinge in diesem Geschäft, und das zeigte sich auch in der Allianz für Deutschland: Es gab Eitelkeiten. Nicht nur die Frage, wer besser mit Helmut Kohl kann, sondern wer sich durchsetzt. Ich bekenne mich dazu: Der Auftritt in Halle mit meiner großen Rede und der Ankündigung, hier stehe der nächste Ministerpräsident, das war ein wichtiger Ausgangspunkt, wo ich meine Ziele manifestiert habe. Ich sagte immer, ich will Ministerpräsident werden – das habe ich in dieser historischen Stunde gesehen.
Frage: Stehen Sie dazu auch heute noch?
Schnur: Ja, absolut. Wenn man ein politisches Amt ausübt, muss man den Menschen sagen, was man will. Die Wähler sollten wissen, woran sie sind. Allerdings fehlten uns damals viele Beurteilungsfähigkeiten. Wir dachten, die wirtschaftliche Lage der DDR sei nicht so marode, wie sie dargestellt wurde – oder wie sie sich später herausstellte. Ich glaube, der Demokratische Aufbruch hatte ein Wahlprogramm, das einem Marshallplan für die DDR entsprochen hätte. Ehrlich gesagt bedauere ich, dass ich daran nicht stärker beteiligt war. Mit meinen Kontakten zur Wirtschaft hätte ich das vielleicht voranbringen können.
Frage: Haben Sie das damals beobachtet, oder saß der Schock danach so tief?
Schnur: Ich könnte mir vorstellen, dass andere sich zurückziehen und konsterniert sind, wenn so etwas passiert. Aber ich muss sagen: Erstens war ich über ein Jahr lang krank. Ich bin an der ganzen Situation zusammengebrochen – Herzinfarkt oder nicht, es war pure Erschöpfung. Ich hatte mich nie geschont. Von einer Veranstaltung zur nächsten, immer unterwegs. Dabei habe ich Menschen kennengelernt, die jahrzehntelang im Stillen für andere da waren. Meine Haftbesuche waren keine großen öffentlichen Aktionen. Vielleicht kam mal ein Prozess in die Öffentlichkeit, aber meist durch den Westen. Stille Diplomatie war oft notwendig. Ich habe neulich Zeitungsartikel gefunden, die belegen, dass ich etwa 30.000 Menschen in den Westen gebracht habe, ohne dass sie die Qual einer Inhaftierung durchmachen mussten. Es setzt bitter an, wenn mir dann die Anwaltszulassung wegen angeblicher Verletzung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit entzogen wird. Für mich stellt sich die Frage: Was war wichtiger – Menschen davor zu bewahren, zugrunde zu gehen, oder sie vor Haft zu schützen? Für mich ist das eine klare Sache.
Frage: Würden Sie sagen, diese Kontakte waren damals ein Mittel, um Verbündete zu gewinnen?
Schnur: Ich bin freiwillig meine Verbindung zur Staatssicherheit eingegangen. Es war eine bewusste Entscheidung.
Frage: Aber Sie haben mal gesagt, Sie seien sehr jung gewesen...
Schnur: Ja, sehr jung. Aber das hatte einen anderen Hintergrund. Ich wuchs als Vollwaise in der DDR auf. Mit 16 fand ein Kinderarzt, ein Freund meines Vaters, heraus, dass meine leibliche Mutter noch lebt – im Westen der Bundesrepublik. Das war ein Schock: Mein ganzes Leben hätte anders sein können! Ich hatte eine starke Bindung zu meinen Pflegeeltern, aber der plötzliche Tod meines Pflegevaters war ein Bruch. Meine Pflegeeltern waren ehrlich: „Dass du bei uns bist, ist eine Folge des Krieges.“ Ich erlebte am eigenen Leib, was Krieg anrichtet. Aber da war die Sehnsucht, meine leibliche Mutter kennenzulernen, war da, aber ich dachte: Sie hätte ja kommen können, es war ihr nicht verwehrt. Kurz vor dem 13. August 1961 ging ich über Westberlin zu ihr. Dann wurde ich krank und blieb bis Oktober 1962 dort. Plötzlich hatte ich das Bildungssystem der BRD vor mir. In der zehnten Klasse nannte ich meinen Geschichtslehrer einen Nazi, weil er die Geschichte anders darstellte als in der DDR. Das führte zu Konflikten. Letztlich landete ich wieder in einem Heim im Westen. Meine Mutter hatte Angst, die Spannung war zu groß. Ich war für sie ein wandelnder Vorwurf, auch wenn ich das nicht wollte. Erst 1993, an ihrem Sterbebett, kam es zur Versöhnung. Sie konnte mir nicht sagen, dass sie mich liebt, aber sie tat viel für meine Kinder. Später erfuhr ich, dass sie Jüdin war – das war bitter. Sie muss Qualvolles durchgemacht haben. Dieser Spannungsbogen trieb mich damals jedenfalls zurück in die DDR. Dort wurde ich kontrolliert, musste mich bewähren und landete im Gleisbau. Aber das war für mich eine tolle Zeit: Ich war wissbegierig, las viel, zeigte politisches Interesse. In der Pionierorganisation und FDJ war ich immer vorne dabei. Ich vermute, das hat tiefe Wurzeln in meiner jüdischen Herkunft.
Frage: Werfen Sie sich heute Fehler vor?
Schnur: Über die Jahre mit dem Ministerium für Staatssicherheit kann ich nicht sagen, dass alles fehlerfrei war. Das wäre naiv. Ich erkenne heute, dass meine Tätigkeit auch missbraucht wurde – das kann ich nicht wegdiskutieren. Deshalb stehe ich dazu. Wenn ich mich zum Grundgesetz der Bundesrepublik bekenne, ist das eine klare Entscheidung. Dann sollten andere darüber urteilen – vor allem die Wähler, wenn ich mich zur Wahl stellte. Ich finde es fatal, dass führende Funktionäre des ZK und Politbüros anders behandelt wurden als Menschen wie ich oder andere, die nur ein kleiner Teil des Systems waren, ohne Machtentscheidungen zu treffen. Wir haben in dieser Diktatur gelebt, die heute fast verleugnet wird.
Frage: Wie sehen Sie das?
Schnur: Wenn man jemanden wie mich in die IM-Situation stellt, frage ich: Wer hatte damals den Lösungsweg? Wie kommt man in den Westen, ohne kriminalisiert zu werden? Ohne die Staatssicherheit war das kaum möglich. Man musste jemanden mies machen, um ihn rauszubringen. Gleichzeitig muss ich zugeben, dass das MfS durch mich Informationen über kirchliche Begegnungen bekam. Deshalb sage ich: Man muss sich zur persönlichen Schuld und Verantwortung bekennen. Ich stelle mich jedem fairen Verfahren. Es wurde ja auch eines geführt – rechtskräftig, nicht wegen politischer Verfolgung, sondern nach dem Strafgesetzbuch der Bundesrepublik. Fatal finde ich, dass Originalunterlagen, die mich hätten entlasten können, nicht beigezogen wurden. Ich wurde verurteilt, habe die Bewährungsstrafe verbüßt und muss das akzeptieren. Aber die Bitterkeit über den Entzug meiner Anwaltszulassung bleibt. Das führt zu inneren Spannungen und Kämpfen. Dennoch darf ich nicht so anfangen wie früher und sagen: „Das war alles nicht so, ich wurde gezwungen.“ Das wäre Unsinn. Sehen Sie Joschka Fischer, der für sich in Anspruch nimmt, mit seiner Vergangenheit gebrochen zu haben. Wenn man sich zu seiner Sache bekennt, sollte die andere Seite Respekt zeigen und nicht das Unmenschliche herausstellen. Aber es wird eben weiter mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen.
Frage: Ihre Akten sind also ein Beweis?
Schnur: Ja, ich bin froh, dass sie existieren. Sie dokumentieren die komplizierte politische Situation in der DDR. Besonders ab 1975 wurde meine Zusammenarbeit mit dem MfS intensiver – etwa nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Da stand ich vor der Frage: Gehe ich diesen Weg weiter? Ich traf Menschen mit anderen politischen Auffassungen – Brandt-Anhänger, die einen sozialdemokratischen Sozialismus wollten, eine bessere DDR. Ich fragte mich: Wenn ich jetzt aussteige, verliere ich vielleicht meine Anwaltszulassung. Das war eine reale Angst. Ursprünglich wollte ich gar kein Jurist werden, sondern in die politische Laufbahn – Nachfolger von Egon Krenz, wenn man so will. Aber das Schicksal kam dazwischen: Meine Mutter lebte plötzlich in der BRD, und ich erfüllte die Nomenklatur nicht mehr. Das war ein klarer Bruch in meinem Lebensplan, in der DDR Politik auf höchster Ebene zu machen. Ich glaubte damals an den Frieden – beeinflusst durch meine persönliche Situation, den Verlust meiner Eltern, meinen Status als Vollwaise. Meine Lehrer zwischen der sechsten und achten Klasse förderten meine Gaben. Ich legte mich mit dem Schulleiter an, weil er keine angemessene Rede zum 8. Mai hielt, dem Tag der Befreiung. Das prägte mich. Bis heute meine ich: Wir brauchen Menschen, die sich für die Gesellschaft verantwortlich fühlen, Abgeordnete werden, Ziele setzen. In der DDR wurde ich systembedingt zu einem Werkzeug – das will ich nicht übersehen.
Frage: Haben Sie in den 60ern oder frühen 70ern gedacht, Sie benutzen die Staatssicherheit? Oder merkten Sie, dass sie Sie benutzen?
Frage: Sie sagten, die Diktatur werde inzwischen geleugnet. Was meinten Sie damit?
Schnur: Ja, in der historischen Betrachtung der DDR wird das für mich verleugnet. Die Verfassung legte klar fest, dass die SED die Macht hatte – eine Diktatur. Das war mein Ausgangspunkt in Vorträgen, dokumentiert auf Tonbändern in kirchlichen Stellen. Es ging darum: Wie können wir Bürgerrechte wahrnehmen? Wie ermutigen wir die Menschen? Die Kirche wollte, dass die Leute in der DDR bleiben – dafür mussten wir sie stärken, etwa Eltern in Schulfragen oder bei der vormilitärischen Ausbildung. 1978 stieg ich intensiv in die Wehrdienstverweigerung ein – ein Thema, das mich vorher nicht beschäftigte. Junge Christen, Pazifisten oder politische Ausreisewillige kamen auf mich zu. Ich kämpfte gegen das MfS: „Ihr sperrt junge Menschen ein, die Minister werden könnten!“ Im November 1985 gelang es – keiner meiner Wehrdienstverweigerer oder Bausoldaten wurde mehr inhaftiert, selbst wenn sie sich erst kurz vor der Einberufung erklärten. Das war ein politischer Sieg, auch weil die DDR es sich nicht mehr leisten konnte, anders zu handeln.
Frage: Sie verteidigen sich also damit, dass Sie viel Gutes bewirkt haben...
Schnur: Ich bin froh, dass meine Akten da sind. Sie belegen, wie ich etwa in Güstrow Wehrdienstberatungen abhielt. Die Teilnehmer meldeten den Wehrkreiskommandos ihre Haltung – wenn das nicht geschah, sagte ich: „Geht hin, erklärt es.“ So wurde mancher Einberufungsbefehl zurückgenommen. Bis zum Ende der DDR wurde kein Wehrdienstverweigerer mehr inhaftiert – das ist aktenkundig. Das MfS war bis zuletzt misstrauisch gegen mich. Ich hatte eine Autorität erreicht, die sie störte. Sie wollten keine Konfrontation zwischen Staat und Kirche – für die SED war die Kirche außenpolitisch wichtig, nicht innenpolitisch.
Frage: Manche, die Sie halfen, fühlen sich heute trotzdem von Ihnen verraten.
Schnur: Das muss man mit Verständnis sehen. Bei Freya Klirr und Stefan Krawczyk differenziere ich: Krawczyk wusste 1988, worum es ging – er wollte seine Frau schützen, was ich respektierte. Ich wollte, dass sie das Land verlassen, weil es keine andere Lösung gab. Niemand dachte damals an die deutsche Einheit. Die Bedingungen damals muss man betrachten. Ich bedauere, dass die Originalakten der beiden in meinem Verfahren nicht einbezogen wurden – sie beweisen, dass nicht ich ihre Ausreise bewirkte, sondern Professor Vogel im Beisein von Bischof Forke. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen kann das bestätigen – Frau Williams sagte mir: „Sichern Sie allen, die in den Westen wollen, unsere Hilfe zu.“ In Friedrichsfelde 1988 war die Situation heikel: Antragsteller wollten zu Vogels Büro, umzingelt von Polizei. Ich sagte: „Seid ihr wahnsinnig? Das eskaliert!“ Mit Stolpe nahm ich Listen auf – im Konsistorium wurden sie geschrieben und die Leute in den Westen geleitet.
Frage: Mussten Sie der Stasi immer erklären, was Sie tun, damit sie Sie weitermachen lassen?
Schnur: Ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu meinem Führungsoffizier in Berlin – ein Vertrauen war gewachsen. Er wollte keinen Konflikt zwischen Staat und Kirche, keine Gewalt. Er sagte: „Wenn du dich für uns einsetzt, finden wir Lösungen.“ Bis September 1987 funktionierte das. Dann änderte sich die innenpolitische Lage, und ich vertraute ihm zu lange. Nach den Kommunalwahlen 1989 sagte ich: „Jetzt muss sich etwas ändern.“ Aber niemand dachte damals an ein einheitliches Deutschland – die Zwei-Staaten-Lage war fest in uns verankert. Das trieb mich, eine politische Formation zu unterstützen. Im Sommer sagte ich bei einem Treffen: „Wenn ich frei politisch wirken kann, mache ich das.“ Das MfS wusste davon – es steht in meinen Akten. Sie wollten mich davon abhalten, eine Führungsposition einzunehmen. Doch die Ereignisse überrollten das – etwa als im September 1989 junge Menschen in Leipzig inhaftiert wurden. Ich kämpfte: „Ihr habt nichts Unrechtes getan, wir ziehen das durch.“ Sie kamen frei. Die Bahnhofsgewalt in Dresden, die Ablösung Honeckers – das zeigt: Ich wollte keine Schuld mindern, sondern fand es absurd, dass Menschen, die legal in den Westen wollten, angeklagt wurden. Ich setzte mich ein, dass das nicht geschah.
Frage: Geben Sie sich selbst die Schuld, dass es so kam?
Schnur: Hätte ich früher den Schritt machen sollen und sagen, wie es war. Aber damals konnte ich das nicht. Anfang März 1990 zog ich die Konsequenz, um ein politisches Desaster zu verhindern. Es war meine Entscheidung – auch, weil eine Lebenslüge wegbrach. Ich dachte nur an mein Ziel: den Wahltag, den Höhepunkt. Hätte ich in Berlin gesagt: „Macht meine Akten weg“? Nein, ich war so beseelt von dem, was ich tat – vom stillen Kampf im Gerichtssaal zur Rede vor Massen in Erfurt und Halle. Diese Euphorie packte mich. Ich merkte: Ich kann das. Ich habe das Positive meiner Arbeit stärker gesehen – was sollte mir schon passieren? Erst als die Akten in Rostock auftauchten, dachte ich an Rückzug. Ich wollte der Sache keinen weiteren Schaden zufügen.
Frage: Dachten Sie, das lässt sich wegdiskutieren?
Schnur: Nein, als die geballten Akten da waren, sah ich die Konsequenz. Bis dahin glaubte ich daran. Ich hinterlasse Eindruck, weil ich nie zweifele, wofür ich kämpfe. ich glaube wirklich, was ich tue. Aber Politik ist nüchterner, schärfer, manchmal makaber – das sehe ich heute. Ich würde morgen wieder Verantwortung übernehmen, ohne Wenn und Aber.
Frage: Was denken Sie heute über die DDR-Führung?
Schnur: Die hat der jungen Intelligenz keinen Weg geebnet. Honeckers Erfahrungen aus der Hitlerdiktatur prägten ein starres Feindbild – eine neue philosophische Betrachtung war ihnen nicht möglich. Die Dogmatiker an den Parteischulen hielten am Alten fest, selbst als Gorbatschow den Wandel versuchte. Warum die Jungen keinen Aufstand machten? Die Machtstrukturen waren zu fest. Ein Kartenhaus muss komplett fallen, nicht nur ein Teil. Wir Ostdeutschen haben den Nachteil: Wer sich zur Vergangenheit bekennt, wird geprügelt, während Leugner Vorteile genießen. Ich zweifle, ob wir das politische System der DDR wirklich aufgearbeitet haben.
Frage: Haben Sie nach Ihrem Rücktritt noch einmal mit Helmut Kohl gesprochen?
Schnur: Nein, gar nicht. Ich zog mich zurück. Er machte keine Hässlichkeiten, keine Vorwürfe. Er verstand, wie man zu so einer Biografie kommt, und bewahrte mich vor Vorwürfen. Ich habe nicht geheuchelt, sondern wie ein Wahnsinniger gearbeitet – von Veranstaltung zu Veranstaltung. Mit ihm hatte ich ein gutes politisches und menschliches Verhältnis. Die Allianz für Deutschland, die außenpolitischen Gespräche mit Genscher und der Sowjetunion – das war auch mein Verdienst.
Frage: War Ihre Wahl als Spitzenkanddiat ein taktischer Schachzug mit Kohl?
Schnur: Nein, gar nicht. Das war ein historischer Selbstlauf, getrieben von der Bürgerrechtsbewegung. Als es soweit war, war ich war machtgierig, blendete dmeine Geschichte aus. Hätte ich gesagt: „Ich habe zwei Gesichter, gebt mir eine Chance“, hätte mein Charisma vielleicht überzeugt. Aber so fragte man mich nicht: „Erläutere uns das.“ Dabei zeigen die Akten zeigen alles. Es war ein Verdienst vieler, dass die DDR keinen Bürgerkrieg wie Jugoslawien erlebte. Das MfS wurde zahm – ein Beweis, dass Kräfte politische Veränderung ohne Gewalt wollten. Zu denen gehörte ich. Aber ich hätte früher mit dem System brechen sollen.
Frage: Wie empfanden Sie mit dieser Erfahrung Kohls späteren eigenen Absturz nach so vielen Jahre, in denen er als Einheitskanzler und großer Staatsmann gewürdigt worden war?
Schnur: Als Tragik. Ich kenne das selbst. Er war redlich, aufrichtig. Wir tragen alle ein anderes Ich in uns. Er wollte nichts Unrechtes, sondern das Beste fürs Land. Doch man übersieht eigene Fehler. Er war nicht bestechbar – da bin ich sicher. Seine Politik aus dem Bauch, besonders für Europa, war beeindruckend. Ich empfand es als schmerzlich, nicht mehr mitgestalten zu können – ich verlor viel. Ihm wird es ähnlich gegangen sein.
Frage: Wie haben Sie selbst ihren Fall verarbeitet?
Schnur: Es war ein Fegefeuer, aber ich bin bei Gott geblieben und habe gesagt: Wer weiß, wozu er mich braucht? Ich bekenne mich zum evangelischen Glauben. Mein Freund aus Israel ist Jude – durch Aufenthalte dort spüre ich eine Wurzel. Für mich ist Gott existenziell: Er holte mich aus Tiefen, dafür bin ich dankbar. Es gab Momente, wo ich sagte: „Es reicht.“ Besonders belastend war das für meine Familie. Doch ich glaube, Gott gibt mir Wegweisung. Ich arbeite jetzt viel in Thüringen mit meinem gemeinnützigen Verein und ich sehe, wie Menschen Hoffnungen mit mir verbinden – ohne Umschweife. In den letzten zehn Jahren überwiegt das Bekenntnis zu meiner Arbeit die Kriminalisierung. Die Kritik ist laut, weil sie Zugang zur Öffentlichmkeit hat. Joachim Gauck etwa will nicht einsehen, dass ich seinen Söhnen den Weg in den Westen ebnete – ohne Inhaftierung. Das war nur mit der Staatssicherheit möglich. Das Lob ist leise, aber ich bin es zufrieden.
Frage: Gibt Ihnen das Kraft, noch einmal zurückzukehren, wohin auch immer?
Schnur: Warum nicht? Ich denke politisch, lebe politisch. Ich würde zurückkehren, wenn ich wirtschaftlich unabhängig bin. Mein Haus soll zwangsversteigert werden, ich habe Schulden durch Fehlinvestitionen – weil ich Menschen vertraute. Aber das ist nicht mein Grundproblem. Es macht mich verantwortlich für die Nöte Arbeitsloser, Schwacher. Wir sind keine Gesellschaft für die Schwachen – die Starken haben Chancen. Ich sehe Potenzial für neue politische Verhältnisse. Das Parteienspektrum ist in alten Mustern gefangen, ohne Anstand im Umgang mit Gegnern.
Frage: Haben Sie Rechte am Demokratischen Aufbruch? Am Namen?
Schnur: Nein, ich glaube nicht. Aber ich denke darüber nach, eine neue Bürgerbewegung zu gründen – wo Kapital, Arbeit und Mensch in Verantwortung stehen. Deutschland hat Reichtum – wir könnten Arbeit schaffen, soziale Verantwortung wahrnehmen, Osteuropa stärken. Ich würde ein Parteiamt anstreben, aber erst muss ich meine Verhältnisse ordnen. Mein Hauptziel ist die Rückkehr meiner Anwaltszulassung – dazu müssen meine Schulden weg. Selbst dann wäre es schwer, denn ein Anwalt darf nicht in Vermögensverfall geraten. Meine juristische Arbeit in der DDR war top – das sagen Kollegen heute noch. Sie war ein Mittel, mit dem MfS Dinge anzugehen. Recht und Seelsorge hängen für mich zusammen – Menschen brauchen das heute mehr denn je. Ich hätte Zulauf, mit Leidenschaft als Jurist. Das ist ein Geschenk Gottes.
Frage: Hat Gott viel Mühe mit Ihnen?
Schnur: Ja, doch. Aber er war liebevoller zu mir als andere. Die Kirche hätte zehn Jahre später sagen können: „Er hat sich gewandelt.“ Stattdessen Blockaden. Sie weiß, wie kompliziert es war, Menschen in der DDR zu halten oder gehen zu lassen – etwa durch Grundstückskäufe oder Devisen. Sie hätte eine stärkere Rolle spielen sollen. Ich wollte, dass Menschen nicht zerbrechen, dass die DDR sozial gerechter wird. Eitelkeiten waren da, aber auch Ideale. Ohne Ideale kann man heute nicht politisch wirken. Die Verfasser des Grundgesetzes hatten Weitsicht – daran würde ich für eine neue Kraft anknüpfen. Menschenwürde umsetzen, nicht nur appellieren – das ist entscheidend.
Frage: Wie sah das im Alltag aus? Wie war Ihr Terminkalender in der DDR?
Schnur: Ich habe 16 bis 18 Stunden gearbeitet. Mir gehörte die DDR – das war mein Lebensgefühl. Ich fuhr zu allen Bezirksgerichten, von Meiningen bis Halle. Dort half ich Antragstellern, Inhaftierten. Für die war ich ein Lichtstrahl – jemand schrieb, ohne mich wäre er nicht mehr am Leben. Man kann mich Stasischwein nennen – mir ist wichtiger, dass meine Arbeit sich gelohnt hat. Die Sprache in den Protokollen war nicht meine – das MfS brauchte ihr Vokabular. Ich stellte Leute als Staatsfeinde dar, damit sie raus konnten. Je schlimmer, desto besser.
Frage: Wann sahen Sie Ihren Führungsoffizier zuletzt?
Schnur: Im Oktober oder November 1989. Ein Rostocker Offizier lieferte mich ans Messer – ich verstehe ihn. Es brachte ihn aus dem Konzept, dass ich die Macht ergreifen wollte. Verwunderlich, dass es so spät passierte. Ende 1989, Anfang 1990 wehrte ich mich noch. Erst als die Akten da waren, zog ich zurück.
Frage: Was sagt Ihre Familie heute zu all dem?
Schnur: Ich bin jetzt Einzelkämpfer. Meine Partnerschaft ist daran zerbrochen – ein schwerer Punkt. Meine erste Frau und Kinder waren genauso überrascht. Gespräche im Nachhinein? Ja und nein – es ist zu schwierig, auch durch das Zerrbild der Medien. Ich erkläre es ihnen, bekenne mich dazu. Meine Kinder spürten doch meine harte Arbeit – ich war immer unterwegs, um Menschen zu helfen. Öffentlich darüber zu reden zeigt, dass ich zu meiner Biografie stehe. Für mich selbst halte ich Biografisches fest – kein Buch, es hat noch keinen Titel. Vielleicht „Ich bin’s gewesen“, um dem Leugnen etwas entgegenzusetzen. Ich will Verständnis erlangen und verhindern, dass andere in solche Situationen kommen. Dich sache ist doch: Wie viele Menschen arbeiten heute ehrenamtlich für Verfassungsschutz oder BND? Sicherheit braucht das – aber macht das den Verrat kleiner?