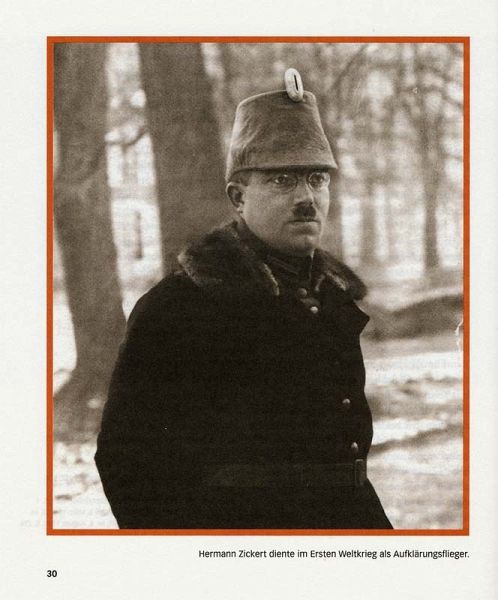Jahrzehntelang galt die Saale als vergifteter Strom. Heute finden Paddler hier idyllische Landschaften. Das weiß nur leider niemand.
Es ist still an dieser engen Stelle vor der malerischen Brücke, an der der Fluss seine ganze Kraft durch eine kaum 30 Meter breite Engstelle presst. Eine Minute, länger schwimmt niemand gegen die Strömung an. Ein Flussregenpfeifer tiriliert, ein paar Frösche quaken. Die Blätter der Bäume am Ufer rauschen. Am Ufer gegenüber geht die Sonne unter.
Wäre nicht der Zug, der gerade nebenan über die Brücke donnert, die Wiese am Parkkiosk von Rolf Wintermann könnte irgendwo an einem schwedischen Flüsschen oder weit im Osten an den masurischen Seen liegen. Spiegelndes Wasser, endloses Grün, völlige Einsamkeit. Doch was sich hier bei Dehlitz, einem winzigen Flecken zwischen Weißenfels und Bad Dürrenberg, tief ins Tal duckt, ist nicht der berühmte Paddelfluss Krutynia und es ist auch kein schwedischer See in den Nordmarken. Sondern die Saale, ein Gewässer, dem noch immer das Image anklebt, stinkend, schmutzig, giftig und überaus hässlich zu sein.
Abschied von der Kloake
Nicht zufällig natürlich. Noch vor einem Vierteljahrhundert war der Fluss, der bei Zell im Fichtelgebirge entspringt und über Thüringen kommend Richtung Elbe fließt, tatsächlich mehr Kloake als Fließgewässer. Leuna, Buna und unzählige andere Fabriken leiteten ihr Abwasser mehr oder weniger ungeklärt ein. Das Saalewasser, eine braune Brühe mit unverwechselbarem Geruch, kroch schaumgekrönt durch die Landschaft. Kaum ein Fisch mehr, kaum noch Leben. Vorbei die Tage, als der 17-jährige Joseph von Eichendorff von Gimritz bis nach Trotha schwamm und der Schwimmverein Schwan am Ufer "Gut Nass, Hurra!" jubelte. Statt "silbern glänzender Wellen", wie sie der begeisterte Saale-Schwimmer Johannes Teller Anfang des vergangenen Jahrhunderts beschrieb, nur stickiger Chemienebel. Mitte der 80er <
> wurden trainierende Ruderer in den Cyanid-Ausdünstungen ohnmächtig, die einschlägigen Grenzwerte waren um das 50-fache überschritten worden. Nach dem Dafürhalten der zuständigen DDR-Behörden hieß das "stark verschmutzt". Und bedeutete: Baden verboten, Paddeln auf eigene Gefahr.
Ein Ruf, der dem Fluss bis heute nachhängt - und das völlig zu Unrecht. Nicht nur, weil sein Wasser längst das Prädikat "chemisch gut" trägt. Sondern auch, weil die Saale alles hat, was sie zu einem beliebten Paddel- und Kanurevier machen könnte: Unberührte Natur mit fliegenden Bussarden und Graureihern, Bachstelzen, Enten und Nutrias, eine touristische Infrastruktur mit Zeltplätzen und Gaststätten, Sehenswürdigkeiten an beiden Ufern und zwischen ihnen einen Strom, der jedes Boot gemächlich schiebt, so dass das Paddeln auch mal unterbleiben kann.
Alles das hat die Saale. Nur Paddler und Kanuten hat sie kaum. Nach einer Untersuchung der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalts halten derzeit nur sechs Prozent der Deutschen die Saale-Unstrut-Region für eine Wassersport-Gegend. "Manchmal kommen zwei, manchmal zwölf", sagt Rolf Wintermann, der in Dehlitz die letzte Verpflegungsstation vor dem weltvergessenen Stück Strecke nach Merseburg betreibt. Das ist der Andrang an einem Wochenende. "Da ist immer mehr los", sagt Wintermann, der seinen Kiosk mit Anlegesteg und Zeltwiese nur nebenbei betreibt. "Leben kann man davon nicht.
Die Zahlen machen es deutlich. Anfang der 90er, als über den wahren Zustand der Saale berichtet werden durfte, wagten sich keine 500 Paddelboote pro Jahr auf den Fluss. Doch je sauberer die Saale später wurde, desto beliebter wurde sie. Fast 8 000 Boote waren 2009 zwischen Naumburg und Barby unterwegs, so viel wie seither nie wieder. Letztes Jahr zählten die Schleusenwärter des Wasserstraßenamtes Magdeburg nicht einmal mehr 5 500 Boote, die zwischen Frühjahr und Herbst auf dem Fluss unterwegs waren. Selbst die Unstrut, die bei Naumburg in die Saale mündet, zieht mehr als dreimal so viele Freizeitkapitäne in Kanadiern und Faltbooten an.

Wenn die Saale bepaddelt wird, dann "gehört die Strecke Camburg - Naumburg zu den am stärksten frequentierten Abschnitten", beschreibt Matthias Beyersdorfer, der Geschäftsführer des Fördervereins Blaues Band e.V. Auch die 90 Kilometer zwischen Halle und der Mündung in die Elbe werden nach Erfahrungen des halleschen Bootsvermieters Thoralf Schwade häufiger befahren als die Strecke von Naumburg nach Halle. Dabei ist die Saale gerade hier eines dieser von Menschen und Massentourismus noch völlig verschonten Gebiete, nach denen Paddler und Kanuten in ganz Europa suchen.
Dennoch setzt am Blütengrund in Naumburg am Morgen nur eine einzige Familie in Faltbooten ein, erfahrene Paddler, bei denen jeder Handgriff sitzt. Vom Start weg ist die Strömung kräftig; die Unstrut, die 400 Meter flussaufwärts in die Saale fließt, drückt mehr als die Morgensonne. Naumburg liegt nur ein paar hundert Meter hinter dem rechten Ufer, ist aber vom Wasser aus genau so unsichtbar wie es später die meisten Dörfer entlang der Route sein werden.
Das Wasser ist klar, kein "Blaues Band", wie die Werbeschilder am Ufer suggerieren, aber ein grünbraunes, das im Licht glitzert. Die Schönburg Ludwig des Springers taucht auf, danach Schloss Goseck. An der Oeblitzschleuse bietet Peter Frick Wasser- und Radwanderern Essen und kalte Getränke. Eine Stunde weiter wartet schon das Bootshaus eines Rudervereins. Es wäre Platz für zahlreiche Paddler, auf dem gemütlich dahinschlängelnden Fluss und auf der Terrasse. "Aber Paddler sind eher selten", sagt die Kellnerin.
Obwohl die Förderservice GmbH der Investitionsbank des Landes den Wassertourismus auf der Saale seit 20 Jahren auf Messen und neuerdings auch im Internet vermarktet, sind nirgendwo welche zu sehen. Stattdessen kommt Weißenfels in Sicht und mit der größten Stadt auf der Strecke auch das Gefühl, dass die alte Saale noch nicht ganz tot ist - hinter der Brückenmühlenschleuse riecht sie nur so.
Masterplan Tourismus
Hier tauchen auch unübersehbare Hinterlassenschaften des Hochwassers von 2013 auf, das den Wassertourismus auf der Saale, der Teil des Masterplan Tourismus 2020 ist, um zehn <
> zurückwarf. Autoreifen liegen im Uferschlamm, Kinderwagen, Badewannen, Fässer und Plastikstühle. Dreck, der niemandem gehört, wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung erklärt. Es trete "kein Abfallbesitz des Bundes ein, da das hierfür erforderliche Mindestmaß an tatsächlicher Sachherrschaft nicht vorhanden ist". Zuständig seien die örtlichen Entsorgungsträger. Die vermutlich keine Schiffe haben.
Zum Glück endet Sachsen-Anhalts hässliches Stück Wasserseite bald. Nun wird das Saaletal wieder zu einem verwunschenen Ort, an dem Outdoorfans und Freizeitkanuten durch waldige, grüne Einsamkeit treiben. Hinter Rolf Wintermanns Kiosk gibt es keine Verpflegungsmöglichkeiten mehr, nur Hindernisse. Die meisten Schleusen sind jetzt auf Selbstbedienung ausgelegt. Funktioniert eine nicht, geht unter Umständen auch niemand ans Telefon. Die noch von Wärtern betreuten Hebewerke dagegen sind wochentags geschlossen und am Wochenende nur halb besetzt. Der Masterplan für Touristen: Wer Kanu und Gepäck nicht umtragen will, übt sich in Geduld.
www.blaues-band.de
www.bootsverleih-halle.de
www.saale-unstrut.de
www.bootsverleih-halle.de