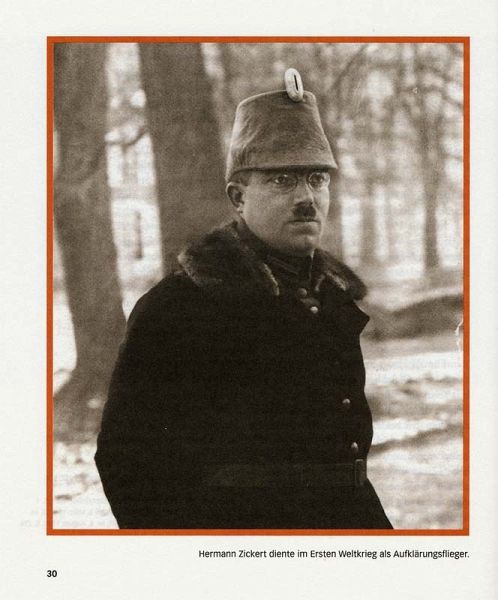Es ist das 30. Jahr nach der Wiedervereinigung, als uns ein bizarrer Plan einfällt: Seit Jahren hatten wir vor, auf dem Kolonnenweg an der ehemaligen Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten entlangzuwandern. Dieser sogenannte Kolonnenweg ist insgesamt 1.400 Kilometer lang, eine zweispurige Linie längs durchs Land.
Dort suchen wir nach dem, was übriggeblieben ist nach drei Jahrzehnten Einheit, danach, was die Natur uns aus der Vergangenheit erzählt und was die Menschen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sagen.
Schon der Name lässt vermuten, dass hier irgendwann einmal etwas passiert ist: Darchau liegt auf der Ostseite der Elbe, "Neu" heißt das hier, weil das mehr als 40 Jahre alte und das neue Darchau voneinander getrennt wurden, als die Elbe zur Grenze zwischen Ost und west wurde. Familien konnten danach nicht mehr zusammenkommen, Brüder konnten einander nicht besuchen, Kinder konnten ihre Eltern jahrzehntelang nicht sehen. Selbst wer von den DDR-Behörden eine Einreisegenehmigung erhielt, musste lange Umwege machen, um die wenigen Meter zum anderen Ufer zu überqueren. Zwischen Darchau im Osten und Neu-Darchau im Westen gab weder eine Brücke noch eine Fähre.
Düsterer Spaß in Neu-Darchau
30 Jahre nach dem Mauerfall und dem Ende der DDR ist zumindest die Fähre da. Aber eine Brücke? Nein. Und das ist besonders merkwürdig, weil die Weltgeschichte sich ausgerechnet hier einen ziemlich düsteren Spaß erlaubt: Wenige Meter hinter Neu-Darchau, das im Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt, beginnt der Landkreis Lüneburg, der sich bis Kriegsende bis hinüber auf die andere Elbseite erstreckte. Die Alliierten beschlossen aber der Einfachheit halber, auch hier eine Grenze in der Mitte des Flusses zu ziehen. Alle Niedersachsen, die im Osten lebten, wurden mit einem Federstrich DDR-Bürger. Wenn sie nicht so schnell wie möglich flüchteten.
Wenn man seinen Rucksack durch diese Landschaft aus alten Bäumen, weiten Wiesen und lächelnden Kühen schleppt, bekommt man nie eine Vorstellung davon, wie fürchterlich hier alles noch vor 40 Jahren gewesen sein muss. Erst nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung, erzählt Angelika, die in Neu-Darchau lebt, konnten Verwandte und Freunde wieder zusammenkommen. Und nach einer Bürgerentscheidung beschloss der Ostteil des Landkreises Lüneburg dann auch ganz schnell, sich wieder mit seinem früheren Westteil zusammenschließen zu wollen. Leider ohne direkte Verbindung: Außer zwei Fähren gibt es nichts bis nach Lüneburg. "Und deshalb führt für uns im Winter bei Eis und im Sommer bei Niedrigwasser keinen Weg hinüber".
Eine neue Brücke soll also schon lange gebaut werden, eigentlich vom ersten Tag der kleinen Wiedervereinigung an. Aber leider liegt der beste Ort dafür nicht im Landkreis Lüneburg, wie Katrin beschreibt, der in Neu-Darchau lebt und ein entschiedener Brückenbefürworter ist. Sondern in Neu-Darchau, nebenan im Landkreis Lüchow-Dannenberg. "Ich finde es gut", sagt Katrin, "aber viele sehen das eben anders."
Je neuer, desto dagegener
Vor allem die vielen Flüchtlinge aus den Großstädten Hamburg und Hannover, die sich hier in den alten bundesdeutschen Tagen der Ruhe in der ehemaligen Grenzregion angesiedelt haben, möchten lieber am Ende einer Sackgasse weiterleben. "Dass die Bauern zur Ernte dorthin hinüber müssen, interessiert die ebenso wenig wie die Probleme der Menschen, die zu Niedersachsen gehören, dort aber im Osten völlig abgeschnitten sind", schimpft Katrin.
Deshalb hängen überall in der Stadt Plakate. Keine Brücke! Ja zur Brücke! Seit Jahren gibt es Streit, denn die Zeiten sind vorbei, in denen, wie vor 30 Jahren in Dömitz, Sehnsucht und Entschlossenheit innerhalb von nur zwei Jahren aus dem Nichts eine riesige Brücke entstehen ließen. Heute braucht es unendlich viel Zeit, unendlich viele Auseinandersetzungen, Streit und Zwietracht. Und am Ende wird doch nicht gebaut, Jahr um Jahr.
Westen im Ostens., Brüder ohne Brücke. Was für ein verrückter Weg.
Englische Version: Here